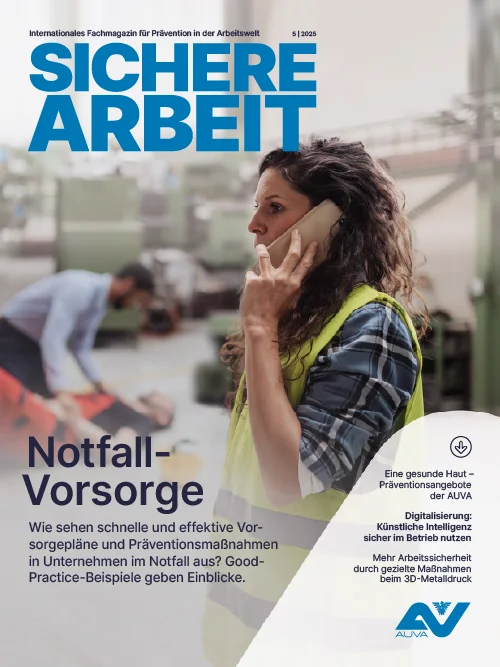Bau
Dombauhütte St. Stephan
Die Dombauhütte des Stephansdoms besteht seit dem Mittelalter. Die UNESCO hat sie in das Register der guten Praxisbeispiele zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Sie zeigt, wie es gelingt, Denkmalschutz und Arbeitnehmer:innenschutz zu vereinbaren – und das trotz oft schwieriger Bedingungen bei den Bauarbeiten am höchsten historischen Gebäude Wiens.
AUVAsicher betreut die Dombauhütte St. Stephan bereits seit einem Vierteljahrhundert. 20 Mitarbeiter:innen sind bei der Dombauhütte angestellt. Zu ihren Aufgaben zählen Reinigung, Restaurierung und Konservierung der Bauteile. Um beschädigte Teile zu ersetzen, fertigen Steinmetze:Steinmetzinnen und Bildhauer:innen in traditioneller Handwerkstechnik Ziersteine wie Krabben und Kreuzblumen.
Arbeiten an der Fassade
Viele der Arbeiten finden in großer Höhe statt, laut Ernest Hugl, Hüttenmeister und Werkstättenleiter der Dombauhütte, zu rund 70 Prozent auf Gerüsten. Aufgrund der architektonischen Gegebenheiten ist der Abstand der Gerüstlagen oftmals geringer als 2 m, wodurch das Tragen eines Helms als hinderlich empfunden wird und Verletzungen der Halswirbelsäule nicht ausgeschlossen werden können. Der Lösungsvorschlag von AUVAsicher war, statt eines Schutzhelms eine Anstoßkappe zu verwenden, wenn sich niemand in einem höhergelegenen Arbeitsbereich aufhält und daher keine Gefahr durch herabfallende Gegenstände besteht.
Für Arbeiten an Stellen, die nicht von einem Gerüst aus erreichbar sind, werden die Anschlagpunkte im jeweiligen Bauteil verankert. Beim Baumaterial des Stephansdoms handelt es sich großteils um mehr als 22 verschiedene Kalksandsteinblöcke, die hauptsächlich aus Calciumcarbonat bestehen. In dem porösen Gestein benötigen die Anschlagpunkte eine große Einbindetiefe, ihre Tragfähigkeit wird durch einen:eine Statiker:in überprüft.
Schutz vor Stäuben
Ablagerungen wie Ruß, Schmutz oder Taubenkot müssen von den Fassadensteinen entfernt werden. „Die Reinigung erfolgt durch Strahlen mit feinem Glaspudermehl“, erklärt Johann Fischer, Einsatzleiter des AUVAsicher-Präventionszentrums Wien und langjährige AUVAsicher-Sicherheitsfachkraft der Dombauhütte. Auch Calcitpudermehl wird verwendet. Man teilt den Arbeitsbereich in Tagesabschnitte und legt jede dritte Gerüstlage mit Schalholz und Planen aus. Die Abschnitte zwischen den abgedichteten Lagen werden mit einer Plane eingehaust und abgesaugt.
Bei der Bearbeitung des Kalksandsteins, in situ bzw. in der Werkstatt der Dombauhütte, entstehen ebenfalls Stäube. Große Steinblöcke werden vor der Dombauhütte mit einer elektrischen Zwei-Mann-Kettensäge zugeschnitten. Um die Staubbelastung für die Beschäftigten zu erheben, führte die Österreichische Staub-(Silikose-) Bekämpfungsstelle (ÖSBS) Quarzstaubmessungen durch. Der Quarzanteil des Kalksandsteins, der aus den Steinbrüchen St. Margarethen im Burgenland und Mannersdorf in Niederösterreich stammt, ist sehr niedrig, es besteht fast kein Risiko durch Quarzfeinstaub.
Auch Holzstaub zählt zu den gefährlichen Arbeitsstoffen. Der beim Brand 1945 zerstörte hölzerne Dachstuhl des Stephansdoms wurde durch eine Metallkonstruktion ersetzt, wodurch in der Dombauhütte vergleichsweise wenige Holzarbeiten anfallen, etwa zur Fertigung von Hilfsgerüsten. Die Kreissäge verfügt über eine direkte Spanabsaugung.
Je nach Arbeitsvorgang wird die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, FFP2-Maske, Gehörschutz oder Anti-Vibrationshandschuhe verwendet. „Schutzausrüstung ist in allen Fällen gegeben“, so Salim Zakeri-Marakani, Sicherheitsfachkraft im Präventionszentrum Wien, der die Dombauhütte seit November 2024 betreut.
Festigungsmittel und Blei
Weitere gefährliche Arbeitsstoffe kommen zur Konservierung der historischen Bausubstanz zum Einsatz. „Auf wertvolle Originalteile oder einzelne Steine, die besonders absanden, tragen wir das Festigungsmittel Kieselsäureester mit Spiritus als Lösungsmittel auf“, erklärt Hugl. Da die Dämpfe entzündlich und beim Einatmen gesundheitsschädlich sind, wird auf gute Belüftung geachtet und die Mitarbeiter:innen verwenden eine Atemschutzmaske.
Bei der Errichtung des Doms wurde Blei als Verbindungsmittel eingesetzt. Die Zulassung dafür ist mittlerweile auf die Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude beschränkt. Am Stephansdom wird Bleiverguss nur angewandt, wenn es sich um historisch mit Blei zusammengefügte Bauteile handelt. Zum Schutz vor giftigen Dämpfen und heißem Blei dienen eine Atemschutzmaske und Hitzeschutzkleidung.
Notfallplanung und Prävention
Für Notfälle hat die Dombauhütte laut Einsatzleiter Fischer vorgesorgt. Es gibt mehrere ausgebildete Ersthelfer:innen, Erste-Hilfe-Kästen befinden sich am Dachboden und am Gerüst. Im Ernstfall kann der Höhenrettungszug der Berufsfeuerwehr angefordert werden.
Im Vordergrund steht die Prävention von Unfällen. Zum sicheren Umgang mit selten verwendeten Arbeitsgeräten finden regelmäßig Nachschulungen statt. Dazu kommen Schulungen durch Externe, im Vorjahr etwa zum Anschlagen von Lasten bei Kranarbeiten und zur Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz. „Alle Schutzmaßnahmen werden laufend evaluiert und bei Bedarf angepasst“, so Werkstättenleiter Hugl. ●


Zusammenfassung:
Die von AUVAsicher betreute Dombauhütte St. Stephan ist ein Vorzeigebeispiel für die Vereinbarkeit von Denkmalschutz und Arbeitnehmer:innenschutz. Besondere Herausforderungen sind die Arbeit in großer Höhe und der Schutz vor Stäuben. ●