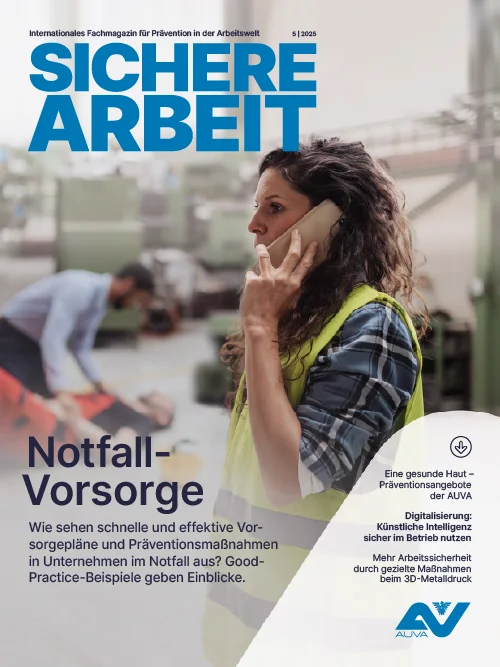Sichere Arbeitsstoffe
Was beim Umgang mit Wasserstoff zu beachten ist!
Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften ist Wasserstoff ein vielversprechender, aber auch gefährlicher Energieträger. Bei der Risikobeurteilung und der Setzung von Maßnahmen im Sinne des Arbeitnehmer:innenschutzes ist einiges zu beachten. Ein Explosionsschutzdokument ist fast immer notwendig.
Wasserstoff ist bei Zimmertemperatur ein farb- und geruchloses Gas, das ca. 14,4-mal leichter als Luft ist. Es ist das Element mit der geringsten Dichte, daher diffundiert Wasserstoff leicht durch poröse Trennwände, aber auch durch Metalle wie Platin. Das Element Nr. 1 hat nach Helium die tiefste Schmelz- und Siedetemperatur.
Aufgrund seines hohen Energieinhalts und der unproblematischen Verbrennung ist Wasserstoff ein vielversprechender, aber auch gefährlicher Energieträger. Für die dementsprechende Bewertung werden sicherheitstechnische Kenngrößen (STK) verwendet. Eine Übersicht über die wichtigsten STK von Wasserstoff im Vergleich mit Methan zeigt die Tabelle 1[1].
Was Wasserstoff so gefährlich macht
Da Wasserstoff durch den Verbrennungsvorgang primär als Energieträger von Bedeutung ist, ist er in den STK dem gängigen Wärme- und Energieträger Erdgas (CH4) gegenübergestellt. In fast allen STK ist Wasserstoff um eine Zehnerpotenz gefährlicher als herkömmliches Erdgas. Auffallend ist neben dem sehr großen Explosionsbereich, dass die Mindestzündenergie ebenfalls um eine Zehnerpotenz geringer ist als bei Methan. Auch die Sauerstoffgrenzkonzentration beträgt bei Wasserstoff weniger als die Hälfte. Zudem ist die Grenzspaltweite geringer, d. h., das Wasserstoffmolekül kann durch einen Spalt / Riss von nur 0,29 mm, z. B. in einer Rohrleitung, eindringen und mit der umgebenden Luft und einer eventuell vorhandenen Zündquelle eine Explosion verursachen. Ebenfalls bemerkenswert und sicherheitstechnisch kein Vorteil: Die Verbrennungsflamme von Wasserstoff ist farblos!
Die STK sind abhängig von Temperatur und Druck. Im Fall von Wasserstoff wird bei höherer Temperatur der Explosionsbereich größer, während die ohnehin schon geringe (Mindest-)Zündenergie noch weiter abnimmt. Steigt der Druck, führt dies zur Reduzierung der Zündenergie im Vergleich zu Normalbedingungen.
Wo Wasserstoff zur Anwendung kommt
Energieversorgungsunternehmen, Chemieindustrie sowie Metallurgie und ähnlich energieintensive Wirtschaftszweige betreiben Anlagen zu Herstellung, Verdichtung, Transport und Verarbeitung von Wasserstoff. Wird dieser mit erneuerbaren Energieträgern gewonnen, spricht man von grünem Wasserstoff. Zu Wasserstoffanlagen zählen:
- Erzeugungsanlagen, zumeist Elektrolyseanlagen (Elektrolyseure)
- Brennstoffzellen
- Gasreinigungs- und Gasaufbereitungsanlagen
- Gasverdichter
- Gasspeicherbehälter
- Gasdruckregel- und -messanlagen
- Rohrleitungen und Rohrregeleinrichtungen: freiverlegt, erdverlegt, Armaturen, Abblase- und Entspannungssysteme sowie Schlauchleitungen
- Verbrauchseinrichtungen wie Hydrierungsanlagen (direkte Verwendung von Wasserstoff), Glühöfen, Schmelzwannen (Glas- und Keramikindustrie) sowie Direktreduktionsanlagen

Zertifizierungssysteme
Durch die Europäische Kommission (EK) positiv bewertete Systeme für die Anerkennung von RFNBOs:
ISCC – International Sustainability & Carbon Certification:
ISCC wurde unter Einbeziehung unterschiedlicher Interessengruppen aus aller Welt entwickelt. ISCC ist ein unter RED II anerkanntes Zertifizierungssystem für erneuerbare Energien, seit 2012 gibt es Zertifizierungslösungen in Märkten außerhalb des Energiesektors. iscc-system.org/
REDcert:
Die REDcert GmBH wurde 2010 von führenden Verbänden und Organisationen der deutschen Agrar- und Biokraftstoffwirtschaft gegründet. Das Unternehmen betreibt bereits Zertifizierungssysteme für nachhaltige Biomasse, Biokraft- und -brennstoffe (REDcert-DE und REDcert-EU) in Deutschland und Europa sowie seit 2018 auch für die stoffliche Biomassenutzung. redcert.org/
CertifHy:
Das Zertifizierungssystem wird durch die öffentlich-private Clean-Hydrogen-Partnerschaft unterstützt. Es wurde speziell für die Zertifizierung von kohlenstoffarm und mit erneuerbaren Energien erzeugtem Wasserstoff und E-Treibstoffen entwickelt. Seit 2014 wird damit zertifiziert. certifhy.eu/
Was bei der Risikobeurteilung zu beachten ist
Aufgrund der Eigenschaften von Wasserstoff ist bei seiner Verwendung fast immer ein Explosionsschutzdokument gemäß § 5 der VEXAT zu erstellen. In Anlagen, in denen Wasserstoff verwendet wird, muss auf eine höchstmögliche Dichtheit abgezielt werden.
Vor allem den Prozessen zur Herstellung einer sauerstoff- bzw. luftfreien Wasserstoffgas-Atmosphäre sowie deren geplanter (bzw. im Störungsfall ungeplanter!) Aufhebung und der dabei möglichen Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre muss gesteigerte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Während der Herstellung bzw. bei der Aufhebung, somit auch im Leckagefall oder bei einer Störung, wird unter Umständen verfahrenstechnisch eine Phase mit der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre durchlaufen.
Die Zerstörung einer explosionsfähigen Atmosphäre, etwa durch Absaugung oder durch Inertisierung mittels Einblasung von Inertgasen, ist eine Maßnahme des primären Explosionsschutzes, der vorrangig anzuwenden ist.
Großen Einfluss auf die Dichtheit von Anlagen haben vor allem Werkstoffauswahl, Planung von Wartungsarbeiten und ähnlichen leitungs- und apparaturinvasiven Verfahren und Mittel zur Überprüfung der Dichtheit. Liegen Explosionsgefährdungen für eine Wasserstoffanlage vor, was fast immer der Fall sein wird, sind für die Anlage technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen.
Sowohl die Beurteilung der Explosionsgefährdung als auch die Festlegung von Schutzmaßnahmen ist von einer fachkundigen Person vorzunehmen. Die Anforderungen für geeignete fachkundige Personen für den Explosionsschutz sind in der ÖNORM Z 2200 festgelegt. Die fachkundige Person für den Explosionsschutz muss beurteilen können, welche Aufgaben und Situationsbeurteilungen sie aufgrund ihrer Kenntnisse und vor allem Erfahrungen in alleiniger fachlicher Verantwortung übernehmen und vertreten kann. Die Gefährdungsbeurteilung und die Schutzmaßnahmen zum Explosionsschutz sind in einem Explosionsschutzdokument zu dokumentieren.
Beim Umgang mit Wasserstoff müssen Gefährdungen durch hohen Druck noch zusätzlich beachtet werden.
Gewerbebehördliche Genehmigungsverhandlungen
Aus Sicht des Zentral-Arbeitsinspektorats wird es bei der Beurteilung von Projektunterlagen insbesondere um die Prüfung folgender Merkmale eines Projektes gehen, um den erforderlichen Explosionsschutz zu gewährleisten (VEXAT):
- Eignung der verwendeten Werkstoffe, Anlagenteile, Dichtungen(!) und Komponenten
- Alterungseffekte
- mechanische Belastungen, Einsatztemperaturen inkl. Temperaturschwankungen
- sonstige verwendete Medien
- (wiederkehrende) Überprüfung von Rohrleitungen, Anlagen und Messeinrichtungen
- Maßnahmen zur Überprüfung der Dichtheit, Ausmaß und Frequenz der Überprüfungen
- Die Geometrie der Ex-Zone muss an Wasserstoff und den Druck in der Anlage angepasst sein. Wasserstoff ist leichter als Luft, kann sich in Deckennähe oder Zwischendecken sammeln, bei hohen Drücken und möglichen Leckagen ist die resultierende Ex-Zone größer.
- Einsatz von Gaswarnanlagen, in Deckennähe / größerer Höhe und allenfalls Aktivierung von Not-Aus und Lüftung
- Einsatz von Gasleck-Suchgeräten und von personengetragenen mobilen Gasdetektoren
- Geometrie der Anlage: Vermeidung von schlecht durchströmten Stellen
Lösbare Verbindungen müssen ein höchstes Maß an Dichtheit ermöglichen. Lösbare Verbindungen sind in sehr beengten Räumen, Gehäusen etc. nicht zulässig.
Die meisten Moleküle sind deutlich größer als das Wasserstoffmolekül. Eine erste Dichtheitsprüfung zur Beseitigung größerer Undichtheiten kann mit einem unbrennbaren Gas wie z. B. Stickstoff erfolgen. Erst anschließend sollte eine Dichtheitsprüfung mit Wasserstoff durchgeführt werden. Abgesehen von der „finalen“ Dichtheitsprüfung mit Wasserstoff selbst eignet sich meist nur noch Helium für eine ausreichende Überprüfung der Dichtheit. Die Restkonzentration der verwendeten Spülgase bzw. des Wasserstoffs darf jeweils 1 % H2 bzw. 1 % Spülgas vor Außer- oder Inbetriebnahme nicht übersteigen.
- Sicherstellung der Trennung von wasserstoffführenden und nicht wasserstoffführenden Anlagenteilen
- Wasserstoffkompressoren müssen bei Eindringen von Luft den Verdichtungsvorgang unterbrechen.
- Lagerung von Gasbehältern ausschließlich in definierten Bereichen
- Abblase-Vorrichtungen nur in definierten Zonen im Freien
- ausreichende Erdung bzw. Potenzialausgleich von allen Anlagenteilen, Fahrzeugen etc.
- optisches Auszeichnen der Ex-Zonen auch rund um Überdruckventile und dergleichen
- Eignung von Geräten, Werkzeugen, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitskleidung für den Anwendungsbereich
- Wasserstoff darf nicht mittels Druckstoß in Anlagenteile eingebracht werden, die vorher Luft geführt haben.
- keine explosionsfähigen Gemische innerhalb von Anlagen, da selbst die Reibungswärme beim Auslösen von Ventilen bereits Zündquelle sein kann
Forschungsbedarf
Vor allem in der Materialtechnologie und im metallurgischen Verständnis der Handhabung und Anwendung ist noch einiges an Forschungsarbeit zu leisten. Mess- und Testsysteme werden in folgenden Bereichen benötigt:
- Tanksysteme
- (Schnell-)Kupplungssysteme
- Wasserstoff-Versorgungs- und Betankungsmodule
- Metallurgie
- Teststandlösungen für Elektrolyse und Brennstoffzelle
- Diagnostiksysteme für Elektrolyse und Brennstoffzelle
- Gas- und Produktwasseruntersuchungen im Rahmen von Wasserstoffanwendungen
- spezifische Gasanalysesysteme und Probenahmen
- Sensortechnik
Heutige H2-Speichersysteme verwenden komprimierten H2 mit einem Druck von bis zu 700 bar, der in der Regel durch mechanische Verdichtungstechnologien bereitgestellt wird. Diese sind durch Materialverschleiß und eventuelle Undichtigkeiten bei der Kupplung aufwendig.
Die Verdichtung von H2 als Schlüsseltechnologie ist der derzeitige Engpass in Wasserstoffanlagen. Mechanische Kompressoren nach dem Stand der Technik haben hohe Wartungskosten, hohen Energiebedarf, eine komplexe Bauweise und sind im Betrieb laut. Als Alternative bieten sich elektrochemische Kompressortechnologien an.
Anforderungen aus der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
Damit Wasserstoff auf die Zielsetzungen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU angerechnet werden kann, muss er als RFNBO (Renewable Fuels of Non Biological Origin) anerkannt werden.
Die Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive, RED III) sieht vor, dass bis 2030 der Anteil an in der EU eingesetzten erneuerbaren Energieträgern mindestens 42,5 % betragen muss. Zusätzlich umfasst die Richtlinie eine Reihe von Subzielen für einzelne Sektoren. Zwei dieser Subziele verpflichten Sektoren zum Einsatz von Wasserstoff:
- In der Industrie muss bis 2030 ein RFNBO-Anteil am gesamten eingesetzten Wasserstoff (stofflich und energetisch) von 42 % und bis 2035 bis 60 % erreicht werden.
- Im Verkehrsbereich ist ein kombiniertes Subziel vorgesehen: Bis 2030 sind 5,5 % des Kraftstoffverbrauches durch fortgeschrittene Biokraftstoffe und RFNBOs zu decken (davon müssen RFNBOs mindestens einen Prozentpunkt abdecken).
Damit eingesetzter, erneuerbarer Wasserstoff auf die europäischen Zielsetzungen angerechnet werden kann und damit Subventionen oder vorteilhafte Regelungen in Anspruch genommen werden können, muss er als RFNBO eingestuft werden. Das gilt für national und europäisch produzierten sowie auch für importierten Wasserstoff. Gerade durch grenzüberschreitenden Handel wird es für die Endkunden schwieriger, sicherzustellen, dass sie wirklich nur anrechenbaren Wasserstoff einsetzen. ●
Quellen:
[1] Fachquelle DGUV, BG Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse
Literatur:
Publikationen der European Industrial Gases Association (EIGA):
EIGA IGC Doc 15/06/E, Gaseous Hydrogen Stations
EIGA IGC Doc 121/14, Hydrogen Pipeline Systems
EIGA IGC Doc 211/17, Hydrogen Vent Systems for Customer Applications
Regelwerke zur Thematik Wasserstoff:
DIN EN ISO 13577-2:2021-11 – Entwurf, Industrielle Thermoprozessanlagen und dazugehörige Prozesskomponenten – Sicherheitsanforderungen – Teil 2: Feuerungen und Brennstoffführungssysteme
Zusammenfassung:
Wasserstoff ist ein spezieller Energieträger. Aufgrund seiner Eigenschaften ist bei seiner Verwendung fast immer ein Explosionsschutzdokument gemäß § 5 der VEXAT zu erstellen.
Da das Gasmolekül äußerst klein ist, können auch Mikrorisse in Apparaturen schneller als üblich zum Problem werden. Diese Aspekte müssen bei Sicherheitsüberlegungen in der Arbeitsumgebung berücksichtigt werden. ●