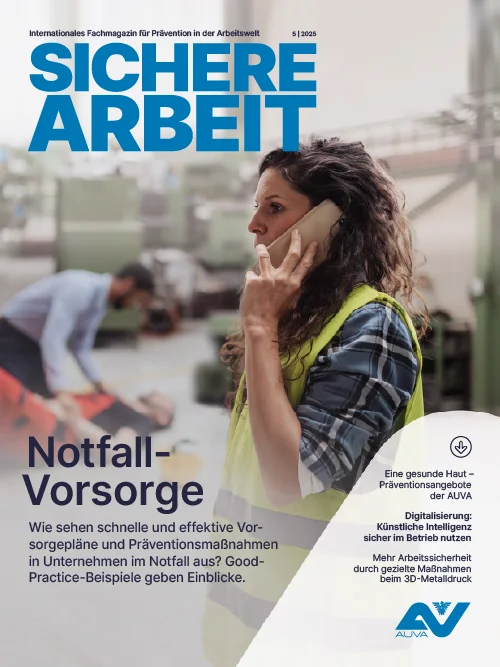Notfall-Vorsorge
Vorsorge für Notfälle
Notfälle treten plötzlich und unerwartet ein. Sie können das Leben und die Gesundheit der unmittelbar Betroffenen bedrohen und auch für Augenzeugen: -zeuginnen negative psychische Folgen haben. Um die Schäden zu begrenzen, sind klare Abläufe notwendig: vom Erkennen und Melden über Erste Hilfe, Rettung und Evakuierung bis zur Übergabe an die Rettungskräfte, wobei die Sicherheit aller Beteiligten im Vordergrund steht.
Ein Notfall kann jedes Unternehmen und jeden:jede Arbeitnehmer:in treffen. Die Ursachen sind vielfältig – ebenso wie die möglichen Folgen, sowohl für einzelne Personen als auch für den gesamten Betrieb. Zu Notfällen zählen Unfälle, Brände, Explosionen, die Freisetzung gefährlicher Stoffe oder Naturkatastrophen. Auch bei Raub, Gewalt bzw. deren Androhung und sexuellen Übergriffen sowie bei Todesfällen durch Suizid spricht man von Notfällen.
Was ist ein Notfall?
Definieren lässt sich ein Notfall – auch im Arbeitskontext – als „ein plötzlich auftretendes Ereignis oder eine Situation, die die Funktionstüchtigkeit eines Systems (körperlich, psychisch, familiär, sozial, ökologisch, technologisch etc.) akut gefährdet“ (Hausmann 2010). Laut Lasogga & Gasch (2008: 13) sind Notfälle „Ereignisse, die aufgrund ihrer subjektiv erlebten Intensität physisch und / oder psychisch als so beeinträchtigend erlebt werden, dass sie zu negativen Folgen der physischen und / oder psychischen Gesundheit führen können“. In solchen Fällen muss sofort gehandelt werden. Die Bewältigung eines Notfalls erfordert einen oft bereichsübergreifenden Einsatz sowohl innerbetrieblicher als auch externer Ressourcen.
Rechtliche Bestimmungen
Die Umsetzung einer geeigneten Notfallvorsorge im Betrieb erfordert eine eingehende Auseinandersetzung mit den rechtlichen Bestimmungen. Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) enthält in mehreren Paragraphen Bestimmungen zu Notfallsituationen, jedoch fast immer, ohne den Begriff „Notfall“ zu verwenden. So verpflichtet etwa § 3 Arbeitgeber:innen dazu, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sich Beschäftigte bei Gefahr unverzüglich in Sicherheit bringen können. Weiters ist durch Anweisungen und sonstige geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer:innen bei ernster und unmittelbarer Gefahr für die eigene Sicherheit oder für die Sicherheit anderer Personen in der Lage sind, selbst die erforderlichen Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung der Gefahr zu treffen, wenn sie die zuständigen Vorgesetzten oder die sonst zuständigen Personen nicht erreichen. Auch im Rahmen der Arbeitsplatzevaluierung sind Vorgehensweisen und Maßnahmen für den Notfall festzulegen. Weitere für Notfälle relevante rechtliche Vorgaben beziehen sich z. B. auf Fluchtwege und Notausgänge, Fluchtmöglichkeiten bei Arbeitsstätten im Freien und Baustellen, Brand- und Explosionsschutz sowie Erste Hilfe, ergänzt durch unterschiedliche Verordnungen.
Das „NEST-Prinzip“
Um auf Notfälle vorbereitet zu sein und im Fall des Falles adäquat reagieren zu können, empfiehlt es sich, Anleitungen und Notfallpläne zu erstellen. Eine Orientierung dafür bietet das „NEST-Prinzip“ der deutschen Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau). Das Akronym „NEST“ steht für:
- Notfall erkennen und melden,
- Erste Hilfe, Rettung und Evakuierung,
- Sicherheit für Ersthelfende, Retter:innen und Betroffene,
- Transport zur Übergabestelle an die Rettung.
Ursprünglich für die unfallträchtige Baubranche entwickelt, lässt sich das NEST-Prinzip auf alle Arbeitsbereiche übertragen. Worauf bei der Anwendung zu achten ist, erläuterte Harald Dippe, MA, von der BG Bau beim Forum Prävention International 2025 der AUVA.
Notfall erkennen und melden
Einen Notfall zu erkennen ist vor allem dann schwierig, wenn die betroffene Person räumlich von ihren Kollegen:Kolleginnen getrennt ist oder es sich um einen Alleinarbeitsplatz handelt. Alleinarbeit sollte daher – wenn möglich – vermieden werden. Muss man davon ausgehen, dass ein Notfall nicht rechtzeitig wahrgenommen wird, empfiehlt sich der Einsatz technischer Hilfsmittel wie Notsignalgeräte (sogenannte Totmannmelder), die bei Bewegungslosigkeit oder fehlender Atemfrequenz automatisch Alarm auslösen. Auf organisatorischer Ebene ist eine regelmäßige Meldung oder Begegnung der Beschäftigten vorzusehen.
Dippe wies darauf hin, dass Notfälle ohne geeignete Maßnahmen auch bei nicht abgelegenen Arbeitsplätzen länger unbemerkt bleiben können, wie die folgenden Fälle zeigen: Ein auf einer Baustelle eingeklemmter Arbeiter rief eine Dreiviertelstunde lang um Hilfe, bis man ihn endlich hörte. Der Baustellenlärm hatte seine Stimme übertönt. In einem anderen Fall dauerte es eine Stunde, bis ein Beschäftigter entdeckt wurde, der beim Abbauen eines Messestands kollabiert war und hinter dem Stand auf dem Boden lag.
Auch das Absetzen eines Notrufs muss im Vorfeld geplant werden, damit im Ernstfall keine kostbare Zeit bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte verloren geht. So ist z. B. bei Baustellen oder Forstarbeiten in abgelegenen Gegenden vor Arbeitsbeginn die Mobilfunkabdeckung zu prüfen. Besteht kein Handyempfang, können Satellitentelefone oder Funkgeräte verwendet werden. Bei Arbeiten im Tunnel kommen oft Signalverstärker zum Einsatz. Verwendet man mobile Geräte, darf nicht vergessen werden, den Akku regelmäßig aufzuladen bzw. einen Zusatzakku mitzuführen. Notrufnummern und – aktuelle – Kontaktdaten der im Notfall zu verständigenden Personen sollten eingespeichert oder als Liste griffbereit sein.
Da sich der:die Meldende in einer Stresssituation befindet, vergisst er:sie möglicherweise, wichtige Informationen mitzuteilen. Das Absetzen eines Notrufs sollte daher im Vorfeld geübt werden. Eine Merkhilfe bieten die „5 W-Fragen“, die in der Regel von der Leitstelle der jeweiligen Einsatzorganisation abgefragt werden:
1. Wo ist der Notfall passiert? Erforderlich ist eine möglichst genaue Ortsangabe mit Adresse und – je nach Örtlichkeit – Stockwerk, Halle, Baustellenabschnitt oder GPS-Koordinaten. Wesentlich ist auch die Beschreibung des Zufahrtswegs, vor allem, wenn dieser erst seit Kurzem besteht. Dippe nannte als Beispiel die noch auf keiner Karte eingezeichnete Zufahrt zu einer neu errichteten Windkraftanlage.
2. Was ist geschehen? Zusätzliche Wahrnehmungen? Eine kurze Schilderung des Ereignisses oder Unfallhergangs hilft der Leitstelle, geeignete Einsatzkräfte zu alarmieren und betroffene Krankenhäuser vorzubereiten. So kann z. B. ein Schockraum rechtzeitig bereitgestellt werden. Die Art des Ereignisses entscheidet darüber, welche Ausrüstung die Einsatzkräfte benötigen und welche Gefahren auch für die Rettungskräfte bestehen könnten.
3. Wie viele Betroffene oder Verletzte gibt es? Die Antwort ermöglicht der Leitstelle, gleich die erforderliche Anzahl an Rettungswagen, Notärzten und Einsatzkräften zu entsenden.
4. Welche Arten von Verletzungen liegen vor? Bei Unfällen und medizinischen Notfällen müssen Angaben zum Zustand der Betroffenen gemacht werden, etwa, ob eine Person bewusstlos ist, eine starke Blutung oder Atemnot hat.
5. Warten auf Rückfragen Manchmal ist es erforderlich, dass die Person, die den Anruf in der Leitstelle entgegennimmt, weitere Fragen stellt. Der:Die Meldende sollte das Gespräch daher nicht eigenmächtig beenden.

Erste Hilfe, Rettung, Evakuierung
ASchG und AStV schreiben vor, wie Erste Hilfe im Betrieb zu organisieren ist. Die dafür vorgesehenen Materialien und Einrichtungen inklusive Anleitungen sind gut zugänglich zu platzieren und eindeutig zu kennzeichnen. Es empfiehlt sich, den Bestand der Erste-Hilfe-Kästen regelmäßig zu überprüfen und verbrauchte oder abgelaufene Produkte umgehend zu ersetzen bzw. an spezielle Rahmenbedingungen der Arbeitsplätze oder Tätigkeiten anzupassen. Ratsam ist die Anschaffung eines Defibrillators, da dieser die Überlebenschance nach einem plötzlichen Herzstillstand deutlich erhöht.
Ersthelfende benötigen eine Ausbildung sowie regelmäßige Auffrischungen. Es müssen jederzeit ausreichend geschulte Personen anwesend sein. Die erforderliche Anzahl ist gesetzlich geregelt, richtet sich nach der Zahl der gleichzeitig tätigen Mitarbeiter:innen und sollte insbesondere bei der Gestaltung von Schichtplänen und der Organisation der Arbeit im Homeoffice beachtet werden.
Rettung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Verletzte oder erkrankte Personen in Sicherheit zu bringen. Bei einer Evakuierung geht es um das sichere, geordnete und schnellstmögliche Verlassen des Arbeitsplatzes im Notfall, was durch gekennzeichnete Fluchtwege, Notausgänge und Sammelplätze sowie bei Bedarf Alarmierungssysteme ermöglicht wird. Rettung und Evakuierung müssen regelmäßig unterwiesen und geübt werden.
Sicherheit für Betroffene und Helfende
Im Notfall muss nicht nur die Sicherheit der Verletzten oder der erkrankten Personen, sondern auch jene der Ersthelfenden und Einsatzkräfte gewährleistet sein. Dazu gehört beispielsweise das Tragen medizinischer Schutzhandschuhe, um direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten zu vermeiden. Abhängig von der Situation kann eine zusätzliche spezielle persönliche Schutzausrüstung (PSA) erforderlich sein – etwa persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bei der Rettung aus Höhen, Atemschutzgeräte im Brandfall oder Chemikalienschutzanzüge bei Gefahrstoffaustritt. Dippe nannte ein konkretes Beispiel: „Wenn jemand bei Dacharbeiten in ein Fangnetz gestürzt ist und sich verletzt hat, muss für den:die Retter:in ein sicherer Zugang geschaffen werden.“ Auch die Bergung des:der Verletzten aus dem Netz und der Abtransport sind zu planen.
Transport zur Übergabestelle
Für den Transport von Verletzten vom Unfallort zum Rettungswagen oder Rettungshubschrauber sind geeignete Hilfsmittel wie Tragen, Spine Boards, Schaufeltragen, Tragetücher oder Schleifkorbtragen erforderlich. Besonders bei schwer zugänglichen Einsatzorten – etwa in engen Schächten oder in unwegsamem Gelände – ist es entscheidend, Transportwege, Zufahrten für Rettungsfahrzeuge oder mögliche Hubschrauberlandeplätze bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.
Praxisbeispiel STRABAG
Ob bei der Planung alle relevanten Aspekte bedacht worden sind und die Mitarbeiter:innen im Ernstfall tatsächlich wissen, wie sie bei Notfällen handeln müssen, lässt sich am zuverlässigsten durch Übungen feststellen. Die STRABAG AG führt, wie durch die Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) vorgeschrieben, regelmäßig Notfallübungen mit unterschiedlichen Szenarien durch.

AUVA-Beratungsangebot
Mit plötzlich auftretenden Notfallsituationen wie schweren Arbeitsunfällen, medizinischen Notfällen, Großschadensereignissen oder gewalttätigen Übergriffen kann im beruflichen Alltag jede:r konfrontiert sein.
Die Literatur zeigt, dass eine rasche psychische Unterstützung der Betroffenen nach einem solchen Ereignis negative gesundheitliche Folgen reduzieren kann. Die AUVA unterstützt Betriebe und Bildungseinrichtungen mit einer Beratung bei der Entwicklung eines notfallpsychologischen Betreuungskonzepts. Je besser man auf unvorhergesehene kritische Ereignisse vorbereitet ist, desto schneller und besser können Unterstützungsmaßnahmen greifen. Das Konzept regelt die Kommunikation im Notfall und legt die Organisation der Betreuung vom Notfall Betroffener bis zum Eintreffen psychosozialer Fachkräfte fest. Führungskräfteschulungen und die Integration der Notfallplanung in die Systeme des Arbeitnehmer:innenschutzes dienen dazu, das Konzept gut im Betrieb zu verankern. Mitarbeiter:innen werden in psychischer Erster Hilfe geschult, um Betroffene in der Akutphase unterstützen zu können, bis professionelle Hilfe zur Verfügung steht.
Von einem Notfall betroffen sind nicht nur die unmittelbar involvierten Personen, z. B. eine verletzte Person nach einem Arbeitsunfall, sondern auch Anwesende wie beobachtende Kollegen:Kolleginnen sowie Personen aus dem sozialen Umfeld der unmittelbar Involvierten, etwa benachrichtigte Angehörige oder weitere Kollegen:Kolleginnen. Dies ist bei der Planung zu berücksichtigen, damit im Fall eines kritischen Ereignisses alle Betroffenen die notwendige Unterstützung erhalten.
Bei Interesse an einer Beratung zur Entwicklung eines notfallpsychologischen Betreuungskonzepts wenden Sie sich bitte an uns unter:
notfallpsychologie@auva.at
Quellen/Literatur
Hausmann, C. (2016). Interventionen der Notfallpsychologie. Wien: Facultas.
Lasogga, F. & Gasch, B. (2008). Notfallpsychologie. Lehrbuch für die Praxis. Berlin, Heidelberg: Springer.
Einige davon stellte Ing. Jürgen Bänsch, Sicherheitsfachkraft und Beauftragter für Health, Safety & Wellbeing bei der STRABAG AG, beim Forum Prävention International 2025 vor.
Bei einem Szenario waren die Übungsteilnehmer:innen damit konfrontiert, dass eine von einem Kran gehaltene Last abstürzte und dabei einen Arbeiter verletzte. Dieser wurde erstversorgt und über eine Stiege zum Rettungsfahrzeug gebracht. Die wichtigste „Lesson learned“ war laut Bänsch, auch die Ursache für den Absturz der Last zu suchen – in diesem Fall ein Herzinfarkt des Kranführers. Mit der Höhenrettung wurde geübt, den Kranführer sicher auf den Boden zu bringen.
Ein weiteres Übungsszenario spielte sich in einem Schacht ab. Beim Abstieg stürzte ein Mitarbeiter, weil eine Sprosse brach. Die Rettung wurde dadurch erschwert, dass die dafür vorgesehene Korbtrage nicht durch die enge Schachtöffnung passte und eine Kollegin eine – simulierte – Panikattacke erlitt. Schließlich konnte der Verletzte über eine andere, breitere Schachtöffnung geborgen werden. Als herausfordernd erwies sich die Betreuung der Kollegin. Außerdem zeigte sich, dass das Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz verstärkt trainiert werden sollte. Bei Arbeiten in Schächten oder Behältern darf auch nicht darauf vergessen werden, eine Freimessung durchzuführen, um sicherzustellen, dass ausreichend Sauerstoff und keine schädlichen Gase oder Dämpfe im Schacht vorhanden sind.
Praxisbeispiel Kardinal Schwarzenberg Klinikum
Notfallsituationen können nicht nur für die direkt Betroffenen, sondern auch für ihnen nahestehende Personen und Augenzeugen:-zeuginnen eine erhebliche Belastung darstellen. Eine rasche psychische Betreuung der Betroffenen kann negative gesundheitliche Folgen reduzieren.
Kardinal%20Schwarzenberg%20Klinikum?qlt=85&ts=1760537457882&dpr=off)
Kardinal%20Schwarzenberg%20Klinikum?qlt=85&ts=1760537595152&dpr=off)
Am Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Salzburg wurde dafür das Programm „KIMA – Krisenintervention für Mitarbeiter“ entwickelt. Es handelt sich um ein dreistufiges Modell zur psychosozialen Unterstützung, das Mag.a Maria Trigler, Leiterin des Psychologischen Dienstes der Klinik, beim Forum Prävention International 2025 präsentierte.
Die erste Stufe bildet ein Entlastungsgespräch mit einem:einer speziell geschulten Kollegen:Kollegin, das innerhalb weniger Stunden nach dem Ereignis niederschwellig in einem vertraulichen Rahmen während der Dienstzeit stattfindet. In rund 95 Prozent aller Fälle erweist sich diese Maßnahme als ausreichend. Falls nicht, folgen innerhalb weniger Tage bis zu drei Stabilisierungsgespräche mit einem:einer an der Klinik tätigen Psychologen:Psychologin oder Psychiater:in aus dem KIMA-Team. Dafür wurde eine eigene KIMA-Hotline eingerichtet. Die dritte Stufe, eine Traumatherapie durch Externe, wurde bisher nur zweimal in Anspruch genommen, jeweils nach einem Patientensuizid. Die Klinik unterstützt bei der Finanzierung der Therapie. Die Evaluierung von KIMA ergab eine Reduktion von Fehlzeiten, Fluktuationen, Konflikten und Kündigungen. Psychische Erste Hilfe kann somit wesentlich dazu beitragen, negative gesundheitliche Folgen nach Notfällen zu reduzieren. Dennoch verfügen bisher nur wenige Unternehmen über ein entsprechendes Betreuungskonzept. Die AUVA bietet Unterstützung bei der Erstellung des Konzepts an. „Im Rahmen der Betriebsberatung zur Entwicklung eines notfallpsychologischen Betreuungskonzepts werden Mitarbeiter:innen in den Basics der psychischen Ersten Hilfe geschult. Sie sollen Betroffene
bei Notwendigkeit bis zum Eintreffen von Kriseninterventionsteams oder weiteren Experten:Expertinnen wie Notfallpsychologen:-psychologinnen unterstützen“, so Mag. Patrick Winkler, Arbeitspsychologe in der AUVA-Hauptstelle.
Zusammenfassung:
Die Pflichten von Arbeitgebern:Arbeitgeberinnen zur Prävention von Notfällen sind in mehreren Rechtsvorschriften geregelt, vor allem im ASchG und in der AStV. Eine Orientierungshilfe, was konkret zu tun ist, bietet das „NEST-Prinzip“ der deutschen BG Bau, vom Erkennen und Melden über Erste Hilfe, Rettung und Evakuierung bis zur Übergabe an die Rettungskräfte.