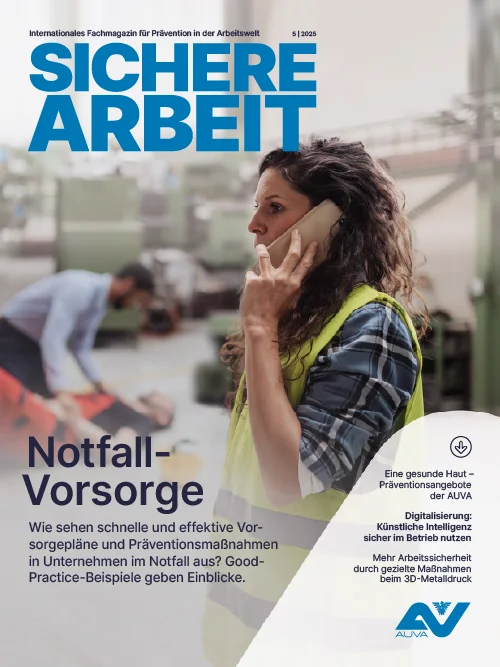Hautschutz
Achtung! Kühlschmierstoffe können die Haut gefährden
Hauterkrankungen sind die häufigsten Erkrankungen, die bei der Verwendung von Kühlschmierstoffen (KSS) auftreten. Feuchtarbeit und weitere Faktoren begünstigen dabei die Entstehung von Handekzemen[1]. Schutzhandschuhe sowie ein passender Hautschutz können die Hände in vielen Fällen schützen. Der Artikel liefert einen Überblick über Hauterkrankungen, die bei der Arbeit mit KSS auftreten können, sowie über notwendige Schutzmaßnahmen.
Die Hauptgefahren beim Umgang mit KSS werden durch mechanische und chemische Einwirkungen verursacht, speziell wenn keine geeigneten Schutzhandschuhe getragen werden (siehe Abbildung 1).
Kühlschmierstoffe sind häufig eingesetzte Hilfsstoffe in der Metall- und Kunststoffbearbeitung und erfüllen wichtige Funktionen wie Kühlen und Schmieren von Werkstücken, Entfernen von Spänen und Schutz vor Korrosion. Um diese technischen Anforderungen zu erfüllen und aufrechtzuhalten, bestehen KSS aus unterschiedlichen chemischen Stoffen. Außerdem können während des Gebrauchs durch Reaktion der Bestandteile miteinander oder durch thermische bzw. mikrobiologische Zersetzung unerwünschte Reaktionsprodukte entstehen und Fremdstoffe (Verunreinigungen wie Metallspäne, Fremdöle, Nitrit, Lebensmittelreste, Zigaretten etc.) von außen eingeschleppt werden. Aufgrund ihrer Inhaltsstoffe bzw. der entstandenen Stoffe können von KSS Gesundheitsgefahren ausgehen.[2]


Beruflich bedingte Hauterkrankungen
Hauterkrankungen gehören zu den häufigsten Berufskrankheiten beim Umgang mit Kühlschmierstoffen. Alle Arten von Kühlschmierstoffen können Hautreizungen oder nicht-infektiöse entzündliche Hauterkrankungen/Ekzeme am gesamten Körper (Gesicht, Beine, Rücken etc.) verursachen, je nachdem, welche Areale des Körpers benetzt werden. In der Regel sind die Hände und Unterarme besonders betroffen.[3]
Regelmäßiger Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen und somit Arbeit in feuchtem Milieu bildet bereits die Grundlage für eine berufliche Hautbelastung. Bei Feuchtarbeit quillt die Hornschicht der Haut auf, die natürlichen Fette der obersten Hautschicht werden herausgelöst und die Schutzfunktion geht zum Teil verloren. Weitere hautgefährdende Faktoren sind das alkalische Milieu von KSS und scharfkantige Metallteile, mit denen hantiert wird, sowie Späne oder mikroskopisch kleine Metallpartikel, die während der Arbeit entstehen können.
Die daraus resultierenden Hautveränderungen (Abbildung 2) machen sich zunächst durch eine juckende Haut und rötliche Hautareale bemerkbar. Die Veränderungen beginnen häufig in den Fingerzwischenräumen. Weitere Symptome sind eine trockene, schuppige, leicht rissige Haut, Schwellungen, Schmerzen sowie auch Bläschen und offene Wunden. Zudem bieten die gestörte Hautbarriere und die offenen Stellen der Haut Eintrittspforten für Keime und Allergene. Dadurch verstärkt sich die Gefahr einer möglichen Sensibilisierung auf verschiedenste Allergene, welche an Arbeitsplätzen zur Metallbearbeitung vorkommen können, und es kann ein allergisches Kontaktekzem entstehen. Zu bedenken ist, dass eine erworbene Allergie lebenslang bestehen bleibt und die Beschwerden auch bei Kontakt mit minimalen Mengen des Allergens ausgelöst werden können. Der Kontakt mit dem Allergen muss daher gemieden werden, was unter Umständen einen Verbleib am bisherigen Arbeitsplatz erschweren kann. Die häufigsten Allergene in der Metallindustrie sind in Tabelle 1 aufgelistet.[1,3]
Eine frühzeitige Diagnose des Abnützungsekzems (irritatives Kontaktekzem) und rechtzeitig gesetzte Maßnahmen am Arbeitsplatz (z. B. Kontaktminimierung, passende Hautschutzmaßnahmen) sowie eine ärztliche Behandlung vermindern die Wahrscheinlichkeit, dass die Veränderungen in einen chronischen Zustand übergehen. Chronische Dermatitiden/Ekzeme können sehr schmerzhaft und belastend sein und dazu führen, dass die betroffene Person den Arbeitsplatz wechseln muss, da einige Aufgaben nicht mehr durchführbar sind. Es ist zu beachten, dass Hautkrankheiten nur dann als Berufskrankheiten (BK 2.1) gelten, wenn und solange sie zur Aufgabe der schädigenden Tätigkeiten zwingen.[3]

Schutzmaßnahmen zur Minimierung der Hautgefährdung
Selbst bei konsequenter Umsetzung aller technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen ist ein Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen nicht ganz vermeidbar. Daher ist es notwendig, dass die Betriebsleitung gemäß der Arbeitsplatzevaluierung (Gefährdung durch Hautkontakt ermitteln, beurteilen, Maßnahmen setzen, Maßnahmen überprüfen) entsprechende Hautschutzmaßnahmen umsetzt. Dazu gehört insbesondere, den Hautkontakt mit KSS auf das Mindestmaß zu beschränken und dem Hautschutzplan eine Schlüsselrolle zu geben[4,5].
Bei der Arbeitsplatzevaluierung müssen alle Hautgefährdungen (physikalische, chemische oder biologische Einwirkungen) und die Eigenschaften der Einwirkungen im gesamten Arbeitsablauf berücksichtigt werden. Im Sicherheitsdatenblatt des KSS werden jene Stoffe angeführt, die eine Irritation oder allergische Reaktion der Haut verursachen können. Ein Vergleich zwischen den Kühlschmierstoffen ist sinnvoll. Möglicherweise kann auf einen Kühlschmierstoff mit weniger gefährlichen Bestandteilen zurückgegriffen werden.
Weiters zu bedenken sind die Art des Hautkontakts (Vollkontakt, Spritzer, Aerosole etc.) und die Häufigkeit der hautgefährdenden Tätigkeiten. Gemäß den Grundprinzipien der Gefahrenverhütung sollte zunächst der Kontakt der Haut mit KSS – und generell Arbeiten in feuchtem Milieu – reduziert oder (wenn möglich gänzlich) verhindert werden.
Die Auswahl von geeigneten Schutzhandschuhen und die Anfertigung des Hautschutzplans erfolgen auf Basis einer umfassenden Evaluierung. Die verwendeten Chemikalien und die Verwendungsdauer der Arbeitsstoffe sind zu berücksichtigen, um die geeigneten Materialien und Materialstärken definieren zu können. Hier hilft häufig der Blick ins Sicherheitsdatenblatt weiter; eine fachliche Beratung ist oft notwendig.[5]
Neben der Schutzwirkung sind auch die Trageeigenschaften zu beachten. Passform, Griffgefühl (Nassgriff, Ölgriff), und Tastempfinden (bei feinmechanischen Tätigkeiten) sind für die Arbeit am Metallarbeitsplatz sehr wichtig. Die Mitarbeitenden sollten in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden. Außerdem sind individuelle Faktoren wie Handschuhgröße und mögliche Allergien auf Handschuhbestandteile (z. B. Thiurame) zu berücksichtigen.[1,5]
Vor der Verwendung der Schutzhandschuhe ist eine Sichtkontrolle notwendig. Es ist zu beachten, dass die Durchbruchzeit ab dem Erstkontakt mit dem KSS gerechnet wird; beim Erreichen von zwei Dritteln der Durchbruchzeit sind die Handschuhe bereits zu wechseln, da sonst ein ausreichender Schutz nicht mehr garantiert werden kann. Nach Überschreitung der Durchbruchzeit müssen die Handschuhe entsorgt werden; eine Wiederverwendung nach Reinigung ist nicht erlaubt. Da der gleichzeitige Umgang mit scharfkantigen Werkstücken oder Spänen und gefährlichen Arbeitsstoffen nicht immer zu verhindern ist, ist die Verwendung eines Handschuhs erforderlich, der gleichzeitig Chemikalien- und Schnittschutz bietet. Einzugsgefahr als Argument gegen das Tragen von Handschuhen besteht nur in Ausnahmefällen. Sie muss im Regelfall durch geeignete Maßnahmen verhindert werden (z. B. geschlossene Anlagen).[1]
Schutzhandschuhe und Hautschutzmittel
Im Allgemeinen haben geeignete Schutzhandschuhe aufgrund ihrer höheren Schutzfunktion Priorität vor Hautschutzmitteln. Hautschutzmittel können zwar die Gefährdung der Haut durch Feuchtarbeit oder schwach hautreizende Stoffe zu einem gewissen Grad verringern, aber nicht völlig verhindern, und sie bieten auch keine Wirkung gegen mechanische Gefährdungen wie Abrieb, Stiche, Schnitte etc. Außerdem ist durch Hautschutzmittel kein Schutz vor gefährlichen Arbeitsstoffen oder Allergenen gegeben, daher sind sie niemals ein Ersatz für erforderliche Schutzhandschuhe[5].
Die beruflichen Hautmittel (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege) sind neben Schutzhandschuhen zur Reduktion der Hautbelastungen entsprechend dem Hautschutzplan zu verwenden. Im betrieblichen Hautschutzplan kann speziell und ausführlich auf die Durchführung der Hautschutzmaßnahmen eingegangen werden. Die Hautschutzmittel sind generell eine präventive Maßnahme und werden vor der Arbeit und nach den Pausen auf die gereinigte Haut aufgetragen. Sie schützen bzw. stärken die physiologische Hautbarriere und helfen daher, eine Hautirritation zu vermindern[4]. Im Gegensatz dazu sollten Hautpflegemittel erst nach der Arbeit aufgetragen werden. Sie helfen bei der Wiederherstellung der bereits beeinträchtigten Hautbarriere bei hautbelastenden Tätigkeiten.
Arbeitshygiene
Persönliche Hygiene am Arbeitsplatz reduziert begleitend zu den oben genannten Maßnahmen unnötigen Kontakt mit KSS[4].
Zum Reinigen verschmutzter Körperpartien, insbesondere der Hände, müssen arbeitsplatznahe, geeignete Waschgelegenheiten mit Papierhandtüchern vorhanden sein, damit gröbere Verschmutzungen der Haut unverzüglich abgewaschen werden können. Eine gründliche Reinigung der Hände vor jeder Pause (auch Rauchpause) darf nicht vergessen werden, aber auf keinen Fall mit Lösungsmitteln (z. B. Bremsenreiniger) erfolgen[1].
Gebrauchte Maschinenputzlappen sind zusätzlich zum Schmiermittel auch mit Spänen behaftet, die die Haut verletzen können, und gehören daher nicht in Hosen- oder Kitteltaschen[4]. Dafür müssen geeignete Behälter vorgesehen sein[1].
Regelmäßiges Wechseln der Arbeitskleidung ist wichtig, insbesondere wenn sie mit KSS durchnässt ist[4].
Wenn Hautveränderungen auftreten
Bei merklichen Hautveränderungen sollte der arbeitsmedizinische Dienst informiert werden. Häufig können dann die bestehenden Schutzmaßnahmen nachgeschärft oder geeignete neue Maßnahmen getroffen werden. Bei Verdacht auf eine beruflich bedingte Hauterkrankung ist oftmals eine dermatologische Behandlung erforderlich und es sollte eine Berufskrankheitenmeldung erfolgen.
Information und Publikationen
Weitere Infos und Publikationen zu Kühlschmierstoffen finden Sie unter:
auva.at/praevention/medien-und-publikationen/publikationen-us/poster-kuehlschmierstoffe-tipps-fuer-sicheres-arbeiten/
Literatur
[1] AUVA-Merkblatt Mplus 369 „Sicherer Umgang mit Kühlschmierstoffen im Betrieb“
[2] Sichere Arbeit 2 | 2024, Seiten 22–25 „Kühlschmierstoffe erfordern sicheren Umgang“
[3] ÖSTERREICHISCHE ÄRZTEZEITUNG 9 | 10. Mai 2024, Seiten 40–42 „Mögliche Gesundheitsgefahr durch Kühlschmierstoffe“
[4] BG ETEM, MB027 „Sicher arbeiten mit Kühlschmierstoffen“
[5] DGUV Regel 109-003 „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen“
Zusammenfassung:
Bei der Arbeit mit Kühlschmierstoffen können Hauterkrankungen entstehen. Geeignete Schutzhandschuhe und Hautschutzmittel können in vielen Fällen die Haut schützen. Allerdings ist auch bei konsequenter Einhaltung von Schutzmaßnahmen der Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen nicht immer vermeidbar. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei dem betrieblichen Hautschutzplan zu.